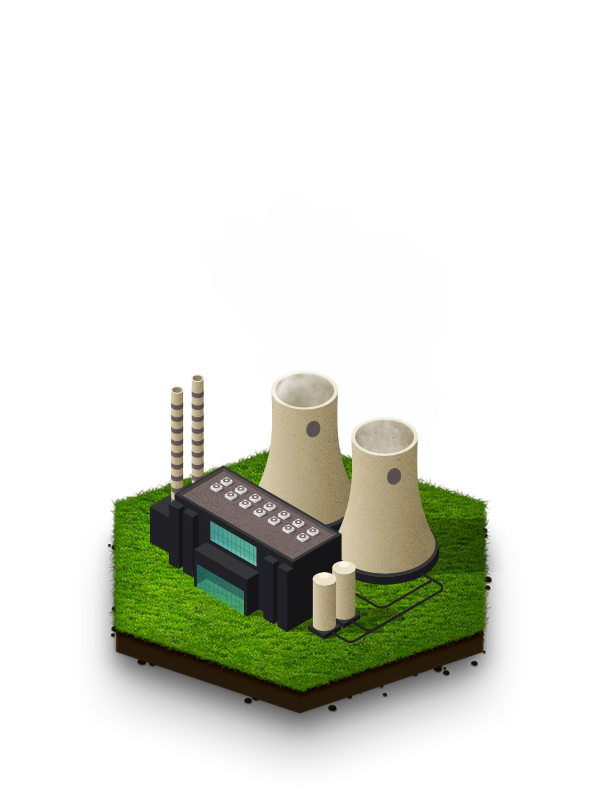Wohin fließt die Kohle?
Wohin fließt die Kohle?
Ein Projekt von MDR und ARD KlimaredaktionDeutschland lässt sich die Energiewende Milliarden kosten. Windräder, Solarparks und der Kohleausstieg – all das braucht Geld. Doch wer profitiert davon? Erfahre, wieviel Gemeinden, Betreiber und Kohlereviere erhalten – und was in deiner Region ankommt!




Gemeinden mit den meisten Windrädern
Gemeinden mit den meisten Solarparks
Gemeinden mit den größten Anteilen der Kohlemilliarden
Wie viel Geld landet in deiner Gemeinde?
Wo Windräder und Solarparks das Landschaftsbild verändern, regt sich nicht selten Widerstand. Um mehr Akzeptanz zu schaffen, hat der Bund ein Gesetz zur finanziellen Beteiligung von Kommunen eingeführt. Betreiber dürfen 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde an die betroffenen Gemeinden zahlen.
Würden alle Betreiber zahlen, stünden den Gemeinden allein im Jahr 2025 rund 353 Millionen Euro zur Verfügung – und das nur durch Windräder. Für Solarparks kämen noch einmal knapp 64 Millionen Euro dazu.
Doch die Beteiligung ist freiwillig und es ist kaum nachvollziehbar, welche Betreiber dieses Geld tatsächlich zahlen. Einige Länder greifen deshalb durch: In Sachsen ist die finanzielle Teilhabe inzwischen verpflichtend, in Thüringen zumindest für Windkraftanlagen. In Sachsen-Anhalt liegt ein entsprechender Gesetzesentwurf bereits vor. Die Regelungen in allen Bundesländern können hier eingesehen werden.
Aktuelle Berichterstattung des MDR zur Energiewende
Lade Inhalte...
Wo sitzen die Betreiber?
der Windräder und Solarparks in deinem Landkreis gehören Betreibern aus deinem Bundesland. Bei 0 Prozent ist der Standort nicht bekannt.
In deinem Landkreis gehören der Windkraftanlagen Firmen mit Sitz innerhalb deines Bundeslands. der Solarparks gehören Unternehmen aus deinem Bundesland.
Knapp 13 Milliarden Euro könnten 2025 aus dem Bundeshaushalt an Betreiber von Windrädern an Land und Solarparks fließen – so die aktuelle Prognose. Das Geld soll den Ausbau erneuerbarer Energien attraktiver machen: Wer investiert, soll auf verlässliche Einnahmen bauen können.
Ein Grund: Strom aus Wind und Sonne bringt nicht immer gleich viel ein. Wetter, Tageszeit und Nachfrage lassen die Preise schwanken. Damit sich der Betrieb trotzdem lohnt, gleicht der Staat die Differenz zwischen dem durchschnittlichen monatlichen Marktwert und dem festgelegten Vergütungssatz aus.
Das Geld fließt nicht in die Region, in der der Strom erzeugt wird – sondern dahin, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. 83 Prozent der Betreiberfirmen sitzen in Westdeutschland – und das, obwohl 2025 nur 65 Prozent der Anlagen dort stehen.
2024 stammten rund 59 Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien – ein Rekordwert. Bis 2030 soll dieser Anteil auf mindestens 80 Prozent steigen.
Trotz Energiewende bleibt aber auch die Kohle ein zentraler Energieträger: 22,5 Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms kamen im vergangenen Jahr aus Kohlekraftwerken – rund 97,2 Terawattstunden. Damit könnten knapp Dreiviertel der deutschen Privathaushalte ein Jahr versorgt werden.
Was kostet der Kohleausstieg?
Doch das Ende dieser Ära ist beschlossen. Mit dem Kohleausstiegsgesetz von 2020 wurde der schrittweise Ausstieg gesetzlich verankert. Spätestens 2038 soll Schluss sein.
Um die wirtschaftlichen Folgen des Kohleausstiegs abzufedern, stellt die Bundesregierung bis 2038 Fördermittel von insgesamt 41,09 Milliarden Euro für die Kohlereviere bereit.
Insgesamt fließen 40 Milliarden Euro an staatlichen Subventionen in das Lausitzer, das Mitteldeutsche und das Rheinische Braunkohlerevier. Etwas mehr als eine Milliarde Euro geht an weitere ehemalige Braunkohleregionen sowie die Standorte abzuschaltender Steinkohlekraftwerke.
Über 26 Milliarden Euro entscheidet der Bund direkt, etwa für Verkehrsprojekte oder Behördenansiedlungen. Die übrigen 14 Milliarden Euro verwalten die betroffenen Länder – so will es das Strukturstärkungsgesetz.
Wie viel Fördergeld jedes Bundesland erhält, ist gesetzlich festgelegt. Den größten Anteil bekommt das Lausitzer Revier in Sachsen und Brandenburg, den kleinsten das Mitteldeutsche Revier in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dazwischen liegt das Rheinische Revier in Nordrhein-Westfalen.
Aktuelle Berichterstattung des MDR zum Kohleausstieg
Lade Inhalte...
Wer bekommt hier eigentlich was?
Ein erheblicher Teil der Mittel ist bereits verplant: Bis Ende 2024 waren hochgerechnet knapp 22 Milliarden Euro konkreten Projekten zugewiesen – mehr als die Hälfte des Gesamtvolumens. Ausgegeben ist davon bisher aber nur ein Bruchteil.
Der Bund hat demnach bis Ende 2024 rund 76 Prozent seines Kohlebudgets in konkreten Projekten gebunden. Bei den Bundesländern dagegen geht es deutlich langsamer voran: Bis Ende 2026 sollen die Länder rund 5,5 Milliarden Euro ausgeben – gebunden ist bislang aber nur gut ein Drittel.
Ein Grund: Die Fördersysteme unterscheiden sich. Während Bundesprojekte zentral geplant und umgesetzt werden, mussten die Länder viele Programme erst aufsetzen – inklusive Personal, Verfahren und Genehmigungen.
Wem wurde bisher das meiste Geld zugeteilt?
Ob das immer die Regionen sind, die das Geld am dringendsten brauchen, ist umstritten.
Wofür werden die Kohlemilliarden ausgegeben?
Ein Großteil der bislang verplanten Mittel fließt in Forschung und Entwicklung, in den Ausbau der Infrastruktur, in den Standortausbau sowie in Bildungsprojekte. Der regionale Fokus unterscheidet sich, liegt aber überall auf der wirtschaftlichen Entwicklung.
Das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) analysiert die Verteilung der Kohlemilliarden und bewertet die bisherige Schwerpunktsetzung insgesamt positiv. Laut IWH fließen die Mittel überwiegend in wachstumsfördernde Bereiche – also in Felder, in denen langfristig neue Wirtschaftsstrukturen und Arbeitsplätze entstehen können. Gleichzeitig empfiehlt das IWH, berufliche Bildung und Standortbedingungen für Fachkräfte stärker in den Fokus zu rücken – denn fehlendes Personal gilt vielerorts als Bremsklotz für den Wandel.
Wie viel Geld ist bereits verplant und wie viel ausgegeben?
Trotz der vielen bewilligten Projekte und der bereits verplanten Milliarden ist bislang nur ein kleiner Teil der Mittel tatsächlich ausgezahlt worden. Vieles ist beschlossen, aber noch nicht umgesetzt – das Geld ist gebunden, aber noch nicht abgeflossen.
Corona, Personalengpässe und neue Vergabeverfahren verzögerten viele Vorhaben. Inzwischen füllt sich die Projektpipeline – doch sichtbare Effekte bleiben bislang meist aus. Laut dem IWH ist das unter den gegebenen Bedingungen nicht anders zu erwarten, Umsetzung und Wirkung bräuchten einfach Zeit.
Die Berechnung der Budget-Werte beruht auf der Annahme, dass die Mittel gleichmäßig über alle Jahre bis 2038 vollständig ausgegeben werden. Die Werte für 2024 wurden hochgerechnet.
Was bewirken die Kohlemilliarden?
Die wichtigsten Zahlen der Braunkohlereviere. Wie weit sind die Reviere von ihren Zielmarken entfernt?
Arbeitsmarkt und Wirtschaft
Arbeitslosigkeit in den Revieren

Im Juni 2025 war die Arbeitslosigkeit in den Braunkohlerevieren um 1,13 Prozentpunkte höher als im deutschen Durchschnitt, ein deutlich geringerer Abstand als noch vor zehn Jahren. Seit 2020 hat sich dieser Abstand allerdings nicht weiter verringert. Dieser Abstand zeigt, dass in den verschiedenen Regionen in Deutschland noch keine gleichen Voraussetzungen auf dem Arbeitsmarkt geschaffen sind. Der Rückgang von Braunkohlearbeitsplätzen hat dabei seit den 2000er Jahren nur noch einen geringen Effekt auf die Arbeitslosenquote in den Revieren.
Abstand der Arbeitslosenquote in den Revieren zum deutschen Durchschnitt
aktuelle Werte in monatlicher Darstellung, Angabe in Prozentpunkten
Wirtschaftsleistung
Durch die Kohlemilliarden soll die Wirtschaftskraft in den Revieren gesteigert werden, um ihre regionalen Defizite auszugleichen. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf - gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen je Einwohner - ist in den Revieren um 8.515 Euro niedriger als im deutschen Durchschnitt. Der Abstand ist heute in allen Revieren größer als vor 10 Jahren.
Abstand des Bruttoinlandsprodukts je Einwohner/in der Reviere zum deutschen Durchschnitt
aktuelle Werte in jährlicher Darstellung, Angabe in Euro
Gesellschaft
Bevölkerungsentwicklung in den Revieren
Die Bevölkerungsentwicklung ist in den einzelnen Revieren sehr unterschiedlich. Während die Bevölkerung in der Lausitz schrumpft, wächst sie im Mitteldeutschen Revier und im Rheinischen Revier.
Bevölkerungsstand in den Revieren
aktuelle Werte in jährlicher Darstellung
Klima
CO₂-Ausstoß der Braunkohlekraftwerke
In den Kraftwerken der Reviere wurden in diesem Jahr bereits 472 GWh Strom durch Braunkohle erzeugt. Dabei wurden schätzungsweise 42 Millionen Tonnen CO₂ ausgestoßen. Im Zuge des Kohleausstiegs sollen die Emissionen auf 0 gesenkt werden. Insgesamt hat Deutschland 2024 rund 646 Millionen Tonnen an CO₂-Äquivalenten ausgestoßen.
Durch Braunkohleverstromung freigesetztes CO₂ in den Revieren
aktuelle Werte in wöchentlicher Darstellung
Energie
Die Abhängigkeit der Stromversorgung von Braunkohlekraftwerken
59 Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms stammten 2024 aus erneuerbaren Energien. Der Rest wurde durch fossile Energieträger wie Kohle und Gas generiert. Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache, spätestens 2038 soll die Kohleverstromung bei null liegen.
Anteil der Braunkohleverstromung aus den Revieren am deutschen Strommix
aktuelle Werte in wöchentlicher Darstellung
Was bleibt?
Ob für den Ausbau erneuerbarer Energien oder den Ausstieg aus der Kohle, die Energiewende bleibt eine riesige Herausforderung – finanziell, logistisch und gesellschaftlich. Denn auch wenn die Milliarden nun fließen, profitiert längst nicht jede Region im selben Maß.
Die Frage, wie gerecht die Energiewende gestaltet wird, bleibt zentral. Wenn Gemeinden leer ausgehen, Betreiber ganz woanders sitzen oder Fördergelder fehlen, wächst der Druck vor Ort. Wo Energie erzeugt wird, entstehen auch Erwartungen – an Beteiligung, Transparenz und Fairness. Erst in einigen Jahren wird sich zeigen, ob die Milliardensubventionen aus dem Steuertopf effektiv angelegt sind und die Regionen voranbringen konnten.
Wie es weitergeht, welche Projekte vor Ort Wirkung entfalten und wo neue Konflikte entstehen, das begleitet der MDR kontinuierlich. Auf mdr.de/energiewende findest du Analysen, Reportagen und aktuelle Berichte zur Energiewende in Mitteldeutschland.